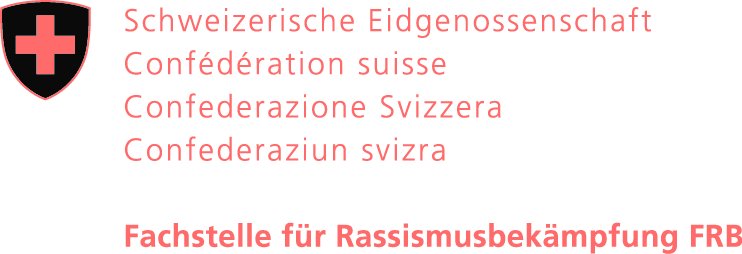Auf dem Weg zu einer Neuen Schweiz
Institut Neue Schweiz

Gastbeitrag von
Halua Pinto de Magalhães,
Institut Neue Schweiz (INES)Eine Schweiz mit Migrationsvordergrund
Das Institut Neue Schweiz (INES) ist ein Think & Act Tank mit
Migrationsvordergrund an der Schnittstelle von Wissensproduktion,
öffentlichem Diskurs und politischem Handeln. Die Arbeit von INES zielt
darauf ab, gesellschaftliche Veränderungen sowohl zu verstehen als auch
mitzugestalten. Denn Migrations- und Diversitätsfragen prägen nicht nur
politische Debatten, sie haben unter anderem auch Einfluss auf den
Arbeitsmarkt, auf Geschlechterfragen, Kultur und Bildung. Deshalb setzt
die Idee einer Neuen Schweiz am Hier und Jetzt an und verbindet das, was
längst da ist mit dem, was sein könnte.
Eine der grössten Herausforderungen, um im Bereich von Migrations- und
Integrationsfragen Veränderungen anzustossen, besteht in den sich
hartnäckig haltenden Bildern und Narrativen einer imaginären Schweiz: zum
Beispiel das Bild eines unabhängigen «Alpenvolks» mit eigener,
freiheitlicher Tradition. Dass andere politische und soziale Realitäten zu
dieser Geschichte dazugehören, wird dabei ausgeklammert. Dieses Bild einer
Schweiz – die es so nicht gibt – entwickelte sich im «Nation Building» des
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und wurde Teil einer kollektiven
Identität. Zur gleichen Zeit festigten sich die Machtstrukturen des
europäischen Imperialismus. Dieser übte nicht nur im
ökonomisch-politischen Sinne eine Fremdherrschaft aus, sondern
beanspruchte für die Europäer:innen auch eine kulturelle Überlegenheit in
der Welt – bis heute sind die Folgen davon zu spüren.
Das Selbstbild der Schweiz als «moderne Nation» ist historisch in
verschiedenen Formen mit dem Imperialismus verknüpft: einerseits materiell
durch die Aneignung von natürlichen Ressourcen aus der ganzen Welt,
andererseits symbolisch-kulturell durch die Abgrenzung zum «Vormodernen»,
dem «Aussen» oder «Anderen» – den Menschen aus den Kolonien. Konstruiert
wurde diese Sicht auf die Welt durch exotisierte-sexistische Werbung,
stereotypisierte Bilder oder identitätsstiftende Traditionen. Noch heute
finden sich Spuren davon im Alltag der Schweizer:innen, beispielsweise in
den rassistischen Emblemen von Basler Fastnachtscliquen oder im Wappen der
Zunft zum «Mohren» in Bern. Die Ursprünge hinter solchen
Traditionen sind mit diskriminierenden Strukturen und institutionellen
Machtpraktiken verbunden. Diese gilt es auszuleuchten und kritisch zu
betrachten.
Das Schweizer Bürgerrecht. Ein Recht für wen?
Ein Beispiel, das Fragen nach historisch gewachsener, struktureller
Diskriminierung gut zu fassen vermag, ist der Zugang zum Schweizer
Bürgerrecht. Ob sich eine Person in der Schweiz einbürgern lassen kann,
hängt vom Entscheid ihrer Wohngemeinde und ihres Wohnkantons ab. Dies,
obwohl die Folgen einer Einbürgerung sich überwiegend auf
bundesrechtlicher Ebene zeigen – schliesslich betreffen sie nichts
Geringeres als das Schweizer Staatsbürgerrecht. Der Grund dafür liegt in
der historisch wichtigen Bedeutung der politischen Gemeinden in der
föderalistischen Schweiz; ihre Wurzeln reichen in die Zeit des
Mittelalters zurück. Eine kleine Gruppe von Menschen – der Gemeinde- und
Kantonsrat oder die lokale Bürger:innenversammlung – kann also über die
Annahme oder Ablehnung eines Gesuchs um Einbürgerung entscheiden, über die
offizielle Aufnahme oder Zurückweisung einer Person aus ihrer Gemeinde.
Eine Folge dieser Entwicklung ist beispielsweise, dass die Anforderungen
für eine Einbürgerung in die Schweiz nicht zwingend in allen Gemeinden
gleich sind. In einigen Gemeinden sind es anstelle objektiver Kriterien
weltanschauliche, der «Tradition» geschuldete Ansichten der zuständigen
Behörden, die über die Einbürgerung einer Person entscheiden.
Einige Beispiele
Insbesondere in kleinen Gemeinden und in Gemeinden, in denen die
Versammlung der Bürger:innen über das Einbürgerungsgesuch entscheidet,
führt eine freie Interpretation des Kriteriums «Integration» zu hohen
Ablehnungsraten mit willkürlichen, teils abstrusen Begründungen, die tief
in die persönliche Freiheit und Lebensführung der Gesuchsteller:innen
eingreifen. In vielen Gemeinden werden überdurchschnittliche Kenntnisse
über die Geschichte der Schweiz, über die Gemeinde und über das politische
System vorausgesetzt. Auch das Verhalten der Gesuchsteller:innen wird
teilweise bewertet und fliesst in den Entscheid hinein: In einem Fall
wurde der Gesuchstellerin vorgeworfen, sie sei nicht integriert, weil sie
mit ihrem Engagement gegen Kuh- und Kirchenglocken Traditionen abschaffen
wolle. Ebenfalls Gründe für eine Ablehnung des Einbürgerungsgesuchs waren,
dass die Person in Trainerhosen durch das Dorf laufe oder die anderen
Bewohner:innen auf der Strasse nicht grüsse. Das Staatssekretariat für
Migration empfahl einem Gesuchsteller für eine erleichterte Einbürgerung
sein Gesuch zurückzuziehen, weil er wegen vereisten Scheiben zu einer
bedingten Strafe verurteilt worden war – er solle es nach Ablauf der
Probezeit nochmals versuchen. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte den
Entscheid für rechtmässig.
Die Dreiteilung des Schweizer Bürgerrechts – Gemeinde, Kanton, Bund –
wurde nie angetastet und wird im heutigen politischen Diskurs als
«nationale Identität» verteidigt. Gleichzeitig fliesst ein Teil dieser
Einbürgerungskriterien in die offizielle Migrationspolitik.
Die koloniale Weltordnung «unterschiedlich entwickelter Kulturkreise» –
Schweiz, Europa, restliche Welt – zieht sich mit dem Schengenraum implizit
bis in die heutige Bürgerrechtsgesetzgebung. Für Personen ausserhalb
Europas ist die Hürde, das Schweizer Bürgerrecht zu erlangen, nochmals
deutlich höher. Die Folge davon: Ein grosser Teil der permanenten
Wohnbevölkerung in der Schweiz hat keinen Schweizer Pass und ist demnach
von der politischen Partizipation ausgeschlossen.
Es zeigt sich also, dass gerade die Frage der Nicht-Zugehörigkeit direkt
an die Lebensrealitäten der postmigrantischen Gesellschaft anknüpft.
Zugehörigkeit setzt einerseits die gesellschaftliche Anerkennung einer
geteilten Geschichte voraus: Es waren aber nicht nur Schweizer:innen mit
rotem Pass, welche die Geschichte des Landes geprägt haben. Andererseits
ist Zugehörigkeit eine politisch-rechtliche Frage: Die Anerkennung muss
mit dem Zugang zu und der Teilhabe an demokratischen Prozessen und
gesellschaftlichen Ressourcen wie Wohlstand, Bildung, Arbeit, Mobilität
oder Diskriminierungsfreiheit verbunden sein. Um dies zu bewerkstelligen,
braucht es ein anderes Wissen über die Schweizer Institutionen und
Traditionen. Dieses Wissen ist in den transnationalen und marginalisierten
Lebenswelten von Migrant:innen verankert, sollte sich aber auch in den
Archiven der offiziellen Schweiz finden lassen. Im Geiste der Neuen
Schweiz können so Gegenwartsanalyse und Zukunftsvision miteinander
verbunden werden, um neue Imaginations- und Gesprächsräume für eine
demokratische Zukunft zu entwickeln – für alle, die da sind und jene, die
noch kommen werden.
übrigens