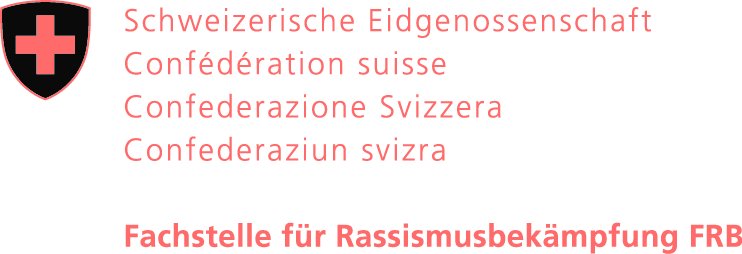An den Glauben glauben
Mission

Mission und Kolonialismus – ein komplexes Verhältnis
Bereits vom 16. bis ins 18. Jahrhundert unterstützte die katholische
Kirche die imperiale Machtausbreitung Spaniens und Portugals. Mit dem
Aufstieg protestantischer Länder wie England und Holland zu
Kolonialmächten im Verlaufe des 18. Jahrhunderts gewann auch die
protestantische
vermehrt an Bedeutung. Die christliche Glaubensausbreitung und die
koloniale Machtexpansion erfolgten somit in zwei zeitlich und geografisch
parallelen Prozessen.
Mission
In den Kolonien waren die Mächte- und Kräftegefüge sehr unterschiedlich:
Die Missionar:innen mussten ihre Position immer wieder verhandeln. Sie
hatten sich nicht nur an die Regeln der Kolonialmacht zu halten, sondern
sie standen auch in permanenten Aushandlungen mit den jeweiligen lokalen
Autoritäten. Die Missionar:innen profitierten von den Machtstrukturen, da
sie vor Ort zur gesellschaftlichen Elite gehörten. Allerdings konnten sie
auch nicht zu stark «kolonial» auftreten und mussten sich immer wieder von
den Kolonisator:innen distanzieren, wenn sie das Interesse der zu
missionierenden Lokalbevölkerung und die Glaubwürdigkeit der Kirche
aufrechterhalten wollten.
Missionare oder Imperialisten? Lies hier mehr dazu.
Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 zeigten sich erstmals die
negativen Effekte dieser engen Verknüpfungen für die Verbreiter:innen
des Christentums: Die Missionar:innen wurden als Vertreter:innen ihrer
Nationen wahrgenommen und aus den Aufenthaltsländern ausgewiesen, wenn
ihr Ursprungsland im Krieg zum feindlichen Lager gehörte. Als Reaktion
darauf formulierte Papst Benedikt XV. 1919 das Schreiben
Maximum Illud, das eine neue Ära in der katholischen Mission
einleiten sollte: Es legte die strikte Neutralität der Missionar:innen
in politischen Fragen fest und bezeichnete nationale und wirtschaftliche
Interessen von Missionen gar als «ansteckende Krankheit». Darüber hinaus
sollten katholische Missionen künftig das Ziel der kulturellen
Verwurzelung der Kirche in den Missionsländern und damit die
Ent-Europäisierung verfolgen: Statt in den Kolonien die katholische
Kirche nach europäischem Muster durchzusetzen, sollte ein einheimischer
Klerus mit jeweiligen kulturellen Eigenheiten gebildet werden.
Mit dem Schreiben Maximum Illud hatte die katholische Kirche
eine Art Leitfaden formuliert, mit dem sie sich offiziell vom
Kolonialismus distanzierte. Die Umsetzung in der Missionspraxis war
nicht immer so einfach. Theoretisch galt die Maximum Illud
für alle Missionar:innen. Wie diese den Inhalt allerdings verstanden und
umsetzten – und was aus ihrer Sicht mit dem Christentum vereinbart
werden konnte –, war nicht überall gleich.
Freiburg wird zum internationalen Missionszentrum
Die zahlreichen Missionsappelle und Impulse nach dem Ersten Weltkrieg, der
Gründungsboom von Missionsvereinen sowie die Verbreitung moderner
Kommunikationsmittel und neuer Verkehrsverbindungen verhalfen der
katholischen Weltmission in der Zwischenkriegszeit zur Blüte. In der
Schweiz fielen diese Entwicklungen am markantesten aus: Einerseits war die
Schweiz vergleichsweise unversehrt aus dem Krieg herausgetreten,
andererseits galt sie als kolonialgeschichtlich unbelastet und politisch
neutral. Rom sah dieses Potenzial und versuchte in der Schweiz den
Grundstein für die Herausbildung einer internationalen, zentrierten
katholischen Missionsbewegung zu legen.
avancierte zum Intellektuellen-Zentrum der katholischen Schweiz und zu
einem internationalen Forschungsplatz für Missionswissenschaften. In
diesem Klima etablierten sich bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 25
Missionsgesellschaften, -vereine und -orden in Freiburg, welche in der
ganzen Welt tätig waren.
Freiburg
übrigens
Wie geht erfolgreich missionieren?
Um erfolgreich missionieren zu können, lernten die Priester und
Ordensschwestern die Sprachsysteme der lokalen Bevölkerungen. Zudem
mussten sie die sozialen Regeln, die Kulturen, Bräuche und Rituale und
Verhaltensweisen der Bevölkerungsgruppen genau verstehen. Ihre
Beobachtungen dokumentierten die Missionar:innen in breitangelegten
Studien, die weltweit zirkulierten und auch ausserhalb religiöser Kreise
wissenschaftliche Anerkennung fanden.


Antoine Marie Gachet:
Der Missionar als Sammler und Forscher
1890 erschien das Tagebuch des Kapuziner-Missionars Antoine Marie Gachet unter dem Titel Cinq Ans en Amérique – Journal d’un Missionnaire. Bis heute interessiert sich die Forschung dafür: Insbesondere die darin enthaltenen Skizzen und Farbzeichnungen vom Leben der einheimischen Bevölkerung werden immer wieder als wertvolle ethnologische Quellen untersucht. Gachet wurde 1822 in Freiburg geboren und missionierte zwischen 1857 und 1862 in Wisconsin, wo er sich während der Christianisierung mit einer einheimischen Bevölkerungsgruppe, der Menomini, mit deren Sprache und Kultur auseinandersetzte.
Gachets visuelle und schriftliche Dokumentationen sind sehr detailliert. Sie erlaubten und erlauben es der ethnologischen Forschung, die koloniale Situation Wisconsins sowie die sozialen, kulturellen und politischen Verhältnisse der Menomini um die Mitte des 19. Jahrhunderts besser rekonstruieren zu können. Zudem zeigen seine Aufzeichnungen, dass sowohl die euroamerikanischen Siedler:innen als auch die einheimischen Bevölkerungsgruppen höchst heterogen waren, sprich: dass es sich dabei nicht um zwei einander gegenüberstehende und in sich einheitliche Gruppen handelte.
Gachets Zeugnisse beschreiben den Austausch zwischen den Kulturen und die kreative Aneignung neuer kultureller Elemente durch die Menomini. Kolonial-stereotype Annahmen von passiven «Indianer:innen» und aktiven Kolonist:innen können so widerlegt werden.
Pater Wilhelm Schmidt:
Mission, Ethnologie und Kulturkreislehre
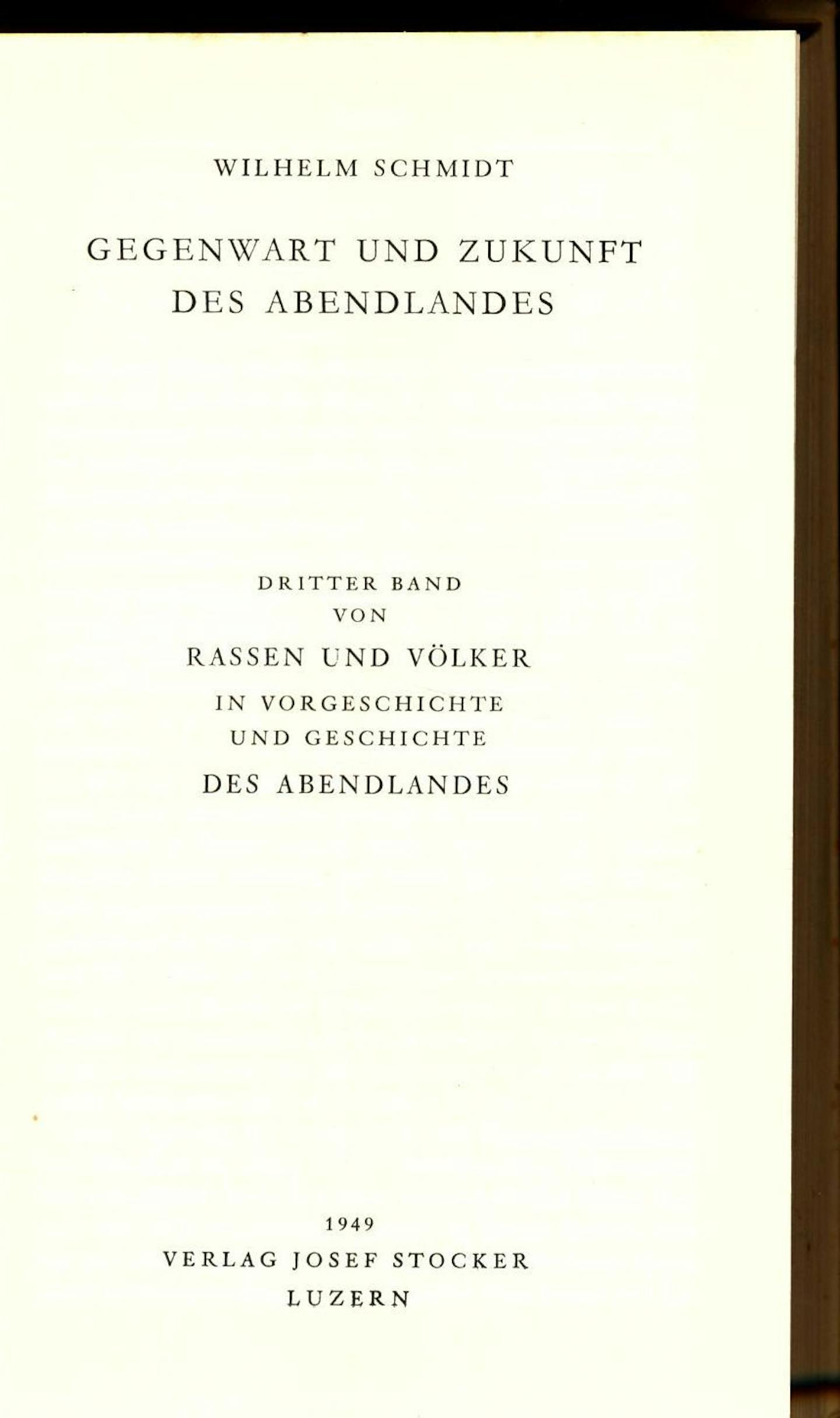
Titelblatt des Buches von Wilhelm Schmidt, erschienen 1949.

1941 rief die Universität Freiburg den Missionar, Ethnologen,
Sprach- und Religionswissenschaftler Wilhelm Schmidt an das extra
für ihn eingerichtete Ethnologische Institut – das erste seiner
Art in der Schweiz. 1938 war Schmidt von Österreich in den Kanton
Freiburg emigriert, wo er im selben Jahr das Anthropos-Institut
gründete. Als Sprachrohr für die katholische Missionsarbeit
entstand daraus die Zeitschrift Anthropos: Internationale
Zeitschrift für Völker- und Sprachkunde.
Schmidt vertrat die Ansicht, dass die missionsethnologische Forschung wichtiger sei als die säkulare Völkerkunde. Die Expertise der Missionare zur «Erforschung des Fremden» sah er im langandauernden, direkten Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung.
Schmidt vertrat die Ansicht, dass die missionsethnologische Forschung wichtiger sei als die säkulare Völkerkunde. Die Expertise der Missionare zur «Erforschung des Fremden» sah er im langandauernden, direkten Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung.
Schmidt selbst war nie missionarisch tätig und betrieb auch keine
Feldforschung. Er beauftragte jedoch seine Schüler, die in den
Kolonien missionarisch tätig waren, empirisches Material über «die
Fremden» zur Untermauerung seiner Thesen zu sammeln.
Weltweite Rezeption erfuhr seine Kulturkreislehre: Er ging davon aus, dass alle Menschen aus einer einzigen Kultur, einer sogenannten Urkultur, entstammen würden. Diese definiere sich durch ein monogames, patriarchales Gesellschaftsmodell sowie religiös durch einen primitiven Monotheismus (Urmonotheismus). Andere Kulturen seien degenerierte Versionen dieser angenommenen Urkultur. Bis 1948 dozierte Schmidt als Professor am Ethnologischen Institut der Universität Freiburg und die Zeitschrift Anthropos gilt bis heute als wichtige Fachzeitschrift der allgemeinen Ethnologie. Seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde bisher durch fünf Ehrendoktorauszeichnungen gewürdigt. Die kolonialen Dimensionen seines wissenschaftlichen Arbeitens wurden allerdings kaum in den Blick genommen und sein Lebenswerk damit bis jetzt noch nicht kritisch beleuchtet.
Weltweite Rezeption erfuhr seine Kulturkreislehre: Er ging davon aus, dass alle Menschen aus einer einzigen Kultur, einer sogenannten Urkultur, entstammen würden. Diese definiere sich durch ein monogames, patriarchales Gesellschaftsmodell sowie religiös durch einen primitiven Monotheismus (Urmonotheismus). Andere Kulturen seien degenerierte Versionen dieser angenommenen Urkultur. Bis 1948 dozierte Schmidt als Professor am Ethnologischen Institut der Universität Freiburg und die Zeitschrift Anthropos gilt bis heute als wichtige Fachzeitschrift der allgemeinen Ethnologie. Seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde bisher durch fünf Ehrendoktorauszeichnungen gewürdigt. Die kolonialen Dimensionen seines wissenschaftlichen Arbeitens wurden allerdings kaum in den Blick genommen und sein Lebenswerk damit bis jetzt noch nicht kritisch beleuchtet.
Mission als Schaufenster und Spiegel?
Schweizer Missionen prägten nicht nur die religiösen, wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Entwicklungen in den kolonialen Gebieten, sondern
sie veränderten auch die Selbst- und Fremdwahrnehmungen sowie
Vorstellungen von der Welt in der Schweiz. Denn getragen wurde der riesige
Erfolg der Missionen von Spender:innen in der Heimat, die damit zu einem
festen Bestandteil des Missionsprojekts wurden. Die breitangelegten
Kampagnen der Missionen eröffneten den Schweizer Katholik:innen ein
Fenster zur Welt und schufen eine Beziehung über grosse Distanz.


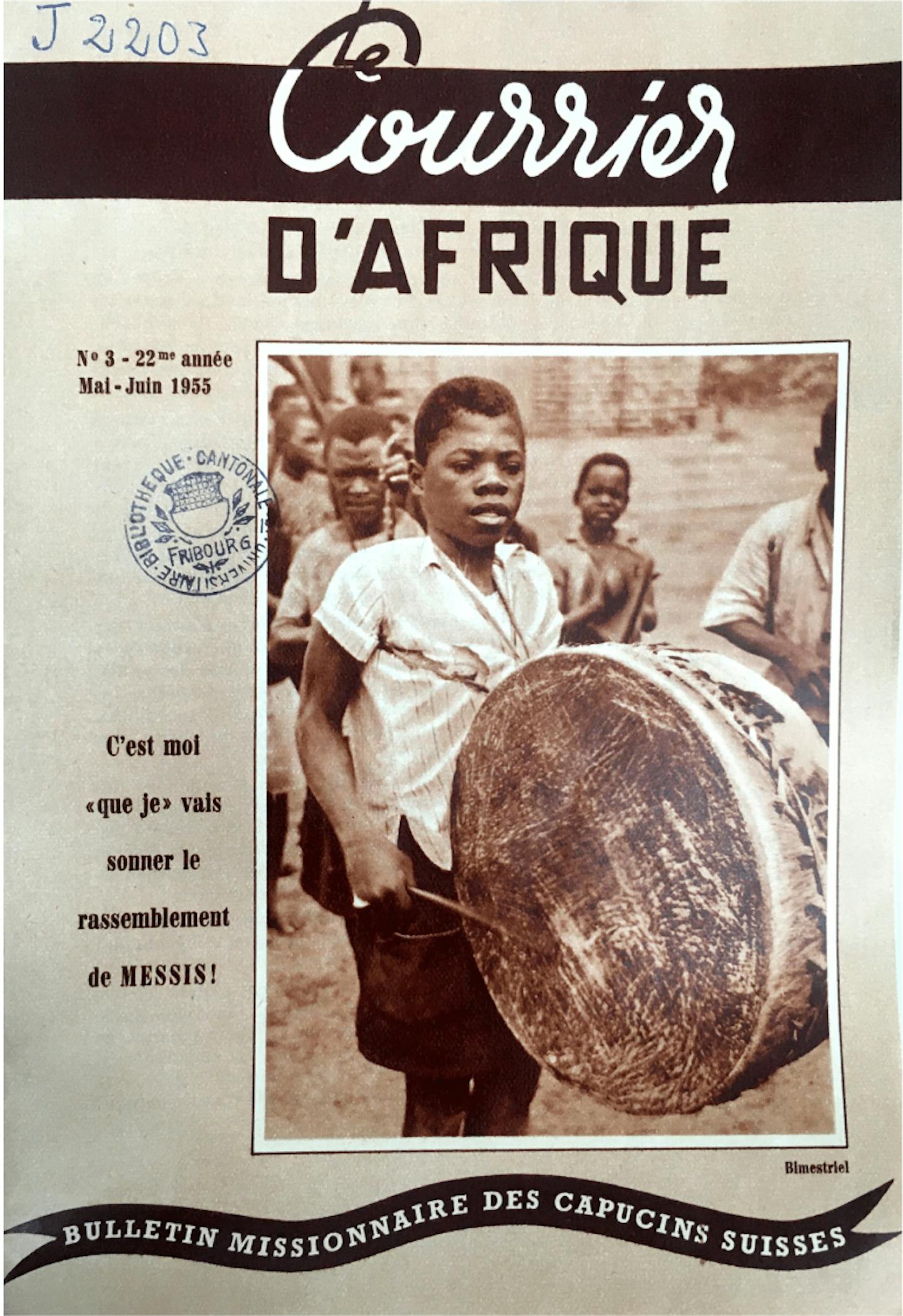
Religiöse Missionen versuchten in ihrer Öffentlichkeitsarbeit eine direkte Beziehung zwischen Schweizer Spender:innen und den zu Missionierenden herzustellen.

In ihren zahlreichen Zeitschriften und Broschüren, in Museen,
Ausstellungen und Filmen, an Spendenbazaren, in der Messe oder an Festen
berichteten die Missionen über ihre Erfahrungen mit den «fremden»
Menschen. Sie prägten damit wesentlich den Blick der Schweizer
Christ:innen auf die aussereuropäische Welt und auf sich selbst.
Einerseits versuchten Missionen zur Sammlung von Spendengeldern, über
die Religion Nähe zwischen den zu missionierenden Menschen und den
Schweizer Gläubigen herzustellen. Andererseits mussten aussereuropäische
Menschen stets als hilfsbedürftig und unterentwickelt repräsentiert
werden, damit den heimischen Christ:innen die Dringlichkeit ihrer
Wohltätigkeit bewusst wurde. Das missionarische
hat daher mit anderen Formen der Herstellung von Selbst- und
Fremdverständnis – wie etwa den Völkerschauen oder der Wissenschaft –
einiges gemeinsam: Es bediente sich kolonialen und rassistischen
Weltbildern. Und doch unterscheidet es sich von diesen Beispielen in
einem ganz zentralen Punkt: Das «Andere» musste als prinzipiell gleich
vorgestellt werden, um dem christlichen Grundsatz der Einheit und
Gleichheit vor Gott gerecht zu werden.
Othering
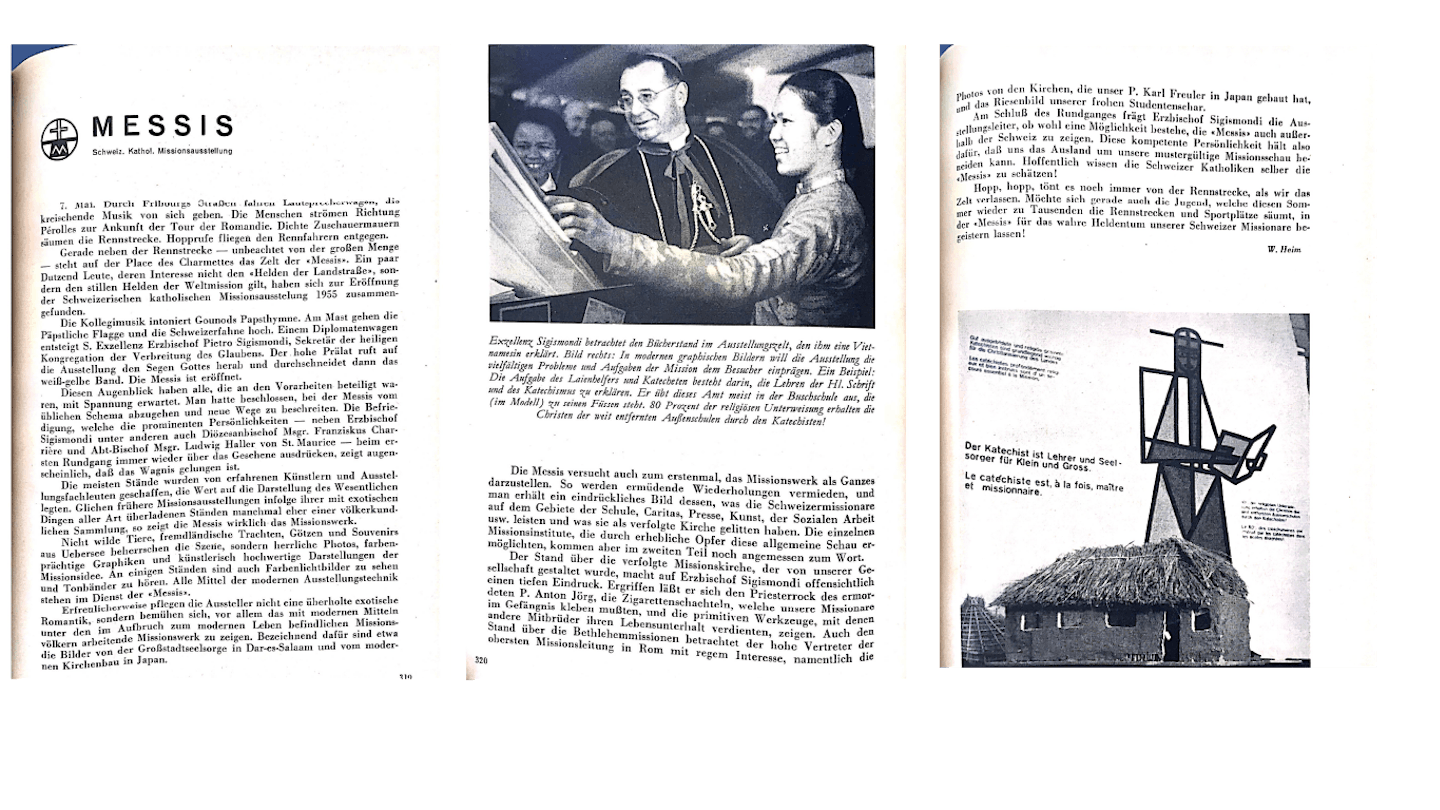
Der Artikel bewirbt die Missionsausstellung «Messis» von 1955. Sie zeuge von einem modernisierten Missionsverständnis, welches befreit sei von «einer überholten exotischen Romantik».

Und heute: Werbeplakate von Hilfsorganisationen
Werbeplakate von Hilfsorganisationen hängen in den Strassen der Schweiz.
Oftmals reproduzieren sie das
des hilfsbedürftigen fremden Menschen im
, dem mit einer Spende geholfen werden kann. Die Darstellungen spielen
mit Emotionen und den dazugehörigen Assoziationen, wie zum Beispiel
«vorzivilisiert» (Leben in einer Lehmhütte oder einfache Kleidung).
Diese Bilder haben einen Einfluss darauf, wie «fremde» und «eigene»
Identitäten konstruiert werden. Auch wenn die Organisationen hinter
diesen Kampagnen keine absichtlich rassistischen Motive haben: Die
Verwendung solcher Bilder festigt die Vorstellung der Überlegenheit
«der»
Stereotyp
globalen Süden
weissen
europäischen Welt gegenüber «dem» globalen Süden.
2016 sorgte eine Kampagne der Hilfsorganisation
weitergeführt;
2019 porträtierte Helvetas Familien aus Bolivien und Äthiopien .
Helvetas
für Aufsehen. Die Plakate zeigten jeweils drei Gesichter aus drei Generationen, die eine Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Armut nahelegten. Auf dem Bild stehen drei Sätze: «Ging hinters Gebüsch», steht bei der Grossmutter, «ging aufs Plumpsklo», steht bei der Mutter, «drückt die WC-Spülung», steht beim Kind. Diese und weitere ähnliche Geschichten sollten dazu animieren, für «echte Veränderung» Geld zu spenden. Martine Brunschwig Graf, Präsidentin der Eidgenössichen Kommission gegen Rassismus, sagte darüber zur «Schweiz am Sonntag»: «Das ist keine gute Kampagne. Die Bilder arbeiten mit dem Vorurteil, dass Afrikaner nur mithilfe des Nordens Fortschritte erreichen können. Das ist paternalistisch.»Helvetas
verteidigte gegenüber der «Schweiz am Sonntag» die Kampagne. Schwarze würden auf den Plakaten nicht als rückständig dargestellt. Im Gegenteil: «Die Plakate erzählen die Geschichten von selbstbewussten, würdevollen Menschen, die auf das Erreichte stolz sind und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wir bedauern es, wenn sich durch diese Darstellung jemand verletzt fühlt.» Die Kampagne wird bisheute
Mission dekolonisieren?
Ab dem Ende der 1940er Jahre wurde unter anderem auch in den sich
Ländern Kritik laut, welche die Missionen als das kulturelle Instrument
des
darstellte. Es wurde deutlich, dass die Mission ihr Selbstverständnis den
neuen Verhältnissen in der sich verändernden Welt anpassen musste: Der bis
anhin weit verbreitete
wurde als veraltet und unangebracht definiert und man war sich einig, dass
die früher teils eingesetzten Missionsmittel von Zwang und Gewalt gänzlich
abgeschafft gehörten. Neu rückten Konzepte der kirchlichen Partnerschaft
und Zusammenarbeit in den Vordergrund. Während der Dekolonisation spielten
Missionen und Kirchen sehr unterschiedliche Rollen. Teils bezogen sie
deutlich Stellung für den
Widerstand, teils halfen sie bei der Aufrechterhaltung kolonialer
Herrschaft.
dekolonisierenden
Kolonialismus
Paternalismus
antikolonialen
Eine Kirche ohne Hilfswerk?
Ist eine Kirche ohne Hilfswerk noch eine Kirche? Nein, meint die
Zeitschrift
oft einen Vertrauensvorschuss, da die Religion vielerorts ein wichtiger
gesellschaftlicher Faktor ist – geholfen wird mittlerweile jedem
Menschen, ob religiös oder nicht.
reformiert
im Januar 2022 – der Gedanke der Fürsorge sei in der Religion stark verankert. Studien verweisen auf die Vorteile von Organisationen, deren Werte auf Glauben oder Überzeugung gründen. «Religious faith-based organizations» (religions- und glaubensbasierte Hilfsorganisationen) kennen sich vor Ort meist gut aus, weil sie mit lokalen Partnern schon lange zusammenarbeiten. Zudem geniessen sie imglobalen Süden
übrigens